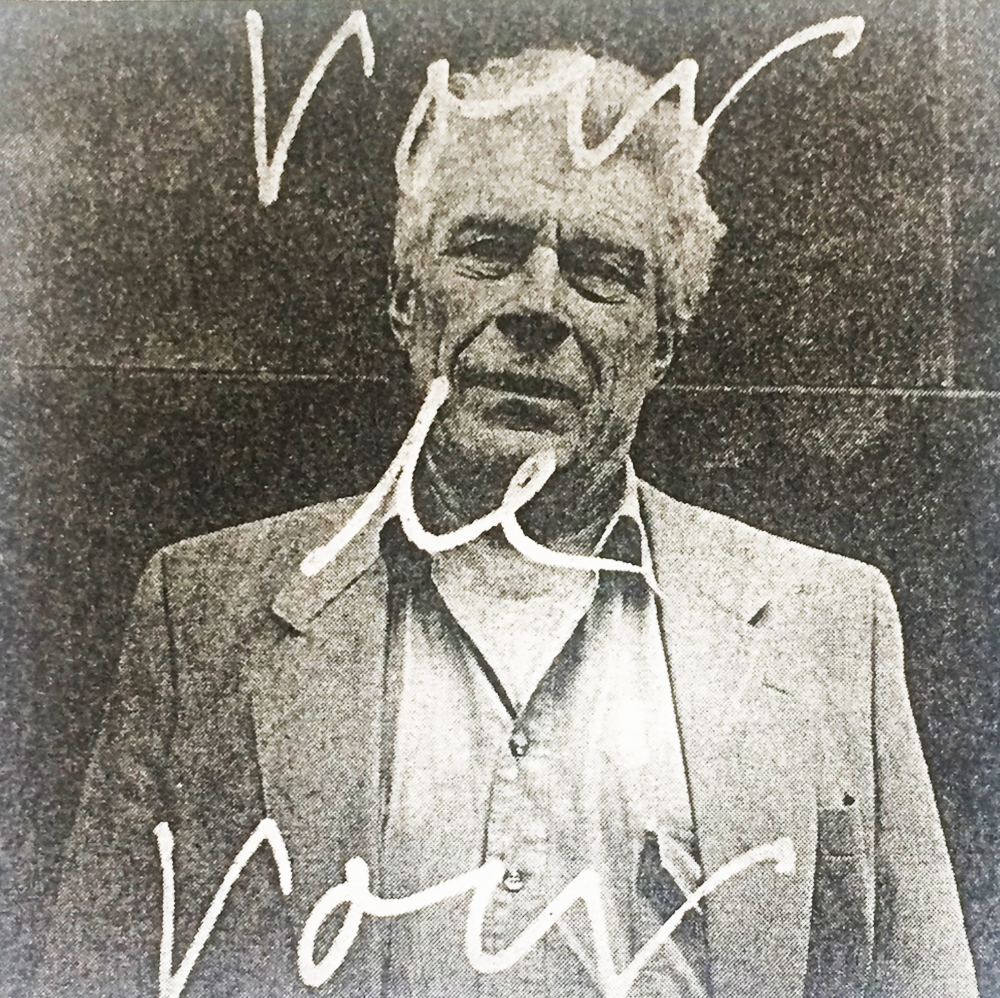Hamburger Rundschau: Mr. Berger, wenn man Ihre Essays und Romane liest, weiß man nie genau, was wichtiger ist – das Beobachtete oder das Erzählte. Ist das eine Art literarisches Programm?
John Berger: Nein, das glaube ich nicht. Wäre es tatsächlich ein Programm oder ein Prinzip, würde es voraussetzen, daß ich es bewußt ausgewählt hätte und einsetzen würde. Das ist jedoch nicht der Fall. Zuerst einmal sehe ich etwas. Ganz spontan – Dinge, vor allem jedoch Menschen. Sich Menschen anzuschauen bedeutet immer etwas mehr, als sie nur anzusehen. Man betrachtet, versucht zu verstehen, urteilt, über ihre Vergangenheit zum Beispiel. Ein Blick ist oft Auslöser einer ganzen Geschichte. Und das, was ich dabei empfunden habe, versuche ich wiederzugeben – so gut ich kann.
Das ist also Ihr Geheimnis.
John Berger: (lacht) Ich denke schon. Sie wissen vielleicht, daß ich Maler war. Allerdings bin ich nie zur Universität gegangen, meine einzige formale Ausbildung war das Sehen.
Gut. Andersrum. Wenn Sie schreiben und Ihre Texte überarbeiten…
John Berger: …sicher, ich überarbeite meine Texte. Aber was korrigiere ich? Ich versuche, mehr auf das zu vertrauen, was ich empfunden und gesehen habe. Dies muß jedoch nicht verbal ausgedrückt sein. Die Dinge beginnen bei mir nicht in Worten. Manchmal finde ich sie zwar recht schnell, schon allein wegen der jahrelangen Schreib-Erfahrung. Aber: Nichts beginnt tatsächlich mit Worten.
Womit dann?
John Berger: Intuition. Aber, das ist eigentlich nur der Auslöser. Worauf es mir ankommt, sind die Dinge, auf die sie mich gebracht hat. Dinge, über die ich sonst nicht gestolpert wäre.
„Nichts beginnt mit Worten.“
Das klingt, als hätten Sie sich für „Mann und Frau, unter dem Pflaumenbaum stehend“ ziemlich weit entfernt von der gesellschaftlichen Analyse, die man beispielsweise in Ihrem Roman „G“ findet. Es scheint, als gäbe es zwei verschiedene Autoren.
John Berger: (zögerlich) Zuerst einmal muß ich sagen, daß es für einen Autor sehr schwierig ist, etwas über seine eigene Arbeit zu sagen. Im Grunde sollte der Leser sie für sich selbst entdecken. Aber – wenn Sie „G“ mit dem neuen Buch vergleichen – beide wurden unter völlig anderen Voraussetzungen geschrieben. Für „G“ brauchte ich acht Jahre.Das neue Buch ist aus einzelnen kleinen Stücken gemacht, die ich im Abstand von etwa vier oder fünf Wochen für die Frankfurter Rundschau geschrieben habe. Ich wollte einmal etwas über Leute machen, die normalerweise nicht in einer Zeitung auftauchen. Keine Prominenten, die lediglich eine Maske zur Schau stellen. Sondern Leute, mit denen wir uns identifizieren. Da es eine Serie war, nannten wir es „Polaroid Fries“. „Polaroid“ – was ja eine moderne, schnelle Foto-Technik ist, und das antike „Fries“, weil es dem Grundgedanken des Nebeneinanderstellens entspricht. Ich hoffte, ohne soziologisch vorzugehen, daß man einen Querschnitt durch Europa erhalten würde, wie die Leute am Ende des 20. Jahrhunderts leben. Ob die Idee funktioniert, soll der Leser selbst entscheiden.
Warum wird das mit keiner Silbe im Buch erwähnt?
John Berger: Nehmen wir mal an, ich hätte das gemacht. Das hätte dann die Geschichten von vorneherein überfrachtet. Worum es mir geht, ist, daß man erst eine Geschichte liest, dann vielleicht eine zweite. Und am Schluß stellt man fest, daß man Leute trifft, die sehr unterschiedlich sind, und doch etwas gemeinsam haben. Es klingt vielleicht ein wenig prätentiös, aber die Geschichten sind ein bißchen im Geist der Erzählungen von Tschechov. Er sagt auch nicht alles, was er mit ihnen ausdrücken will, sondern läßt den Leser mit einer gewissen Rätselhaftigkeit allein.
„Ich wollte einmal etwas über Leute machen, die normalerweise nicht in der Zeitung auftauchen.“
Nichtsdestotrotz wirkt es, als wären Sie von der Gesellschaftsanalyse auf den Mythos, das Archaische umgeschwenkt. Ein Reflex auf eine Zeit, in der nur noch von Simulation und Daten-Autobahnen geredet wird?
John Berger: Wenn Sie sich „Sau-Erde“ oder „Flieder und Flagge“, beides Teile einer Roman-Trilogie, ansehen, werden Sie feststellen, daß sie komplett anders geschrieben sind, als zum Beispiel „G“. Eine Geschichte hängt immer davon ab, über wen sie erzählt wird. Bei „G“ geht es mehr oder weniger um die Bourgeoisie, das 19. Jahrhundert. Es ist – wenn Sie so wollen – die Welt von Musil oder Thomas Mann. Als ich anfing, über Bauern zu schreiben, fiel mir auf, daß ich ganz anders über sie erzählen mußte.Ich hatte anfangs große Schwierigkeiten damit, eine andere Form zu finden, einen Erzähl-Stil, der aus der Erfahrung mit den Bauern, heraus resultierte. Die Geschichten „Unter dem Pflaumenbaum“ sind Geschichten über unterschiedliche Leute. Das ist ein komplett anderes „Setting“, das wiederum eine andere Form des Erzählens nach sich zieht. Ich glaube jedoch nicht, daß diese Geschichten deswegen mehr oder weniger politisch sind als andere, die ich verfaßt habe.
Eine Konstante gibt es ohne Zweifel. Den Tod. Denn der spielt immer eine wichtige Rolle in Ihren Büchern. Sie haben sich – glaube ich – gelegentlich sogar als „Sekretär des Todes“ bezeichnet.
John Berger: Ich habe nicht mich so bezeichnet, sondern die Geschichtenerzähler.
Können Sie das näher erklären?
John Berger: Ich glaube, ich habe den Begriff das erste Mal im Zusammenhang mit Gabriel Garcia Marquez verwendet. Übrigens – auch ein Schriftsteller, den ich sehr bewundere. Und ich hoffe, daß ihm das genauso geht. (Rührt grinsend in seinem Kaffee) Es ist doch interessant, daß man Schriftsteller bewundern kann, ohne sie zu kopieren. Aber, was ich eigentlich meine, ist ziemlich simpel: Jede Geschichte beginnt mit ihrem Ende. Egal wie lang sie ist, sie braucht eine Klimax, einen Höhepunkt. Simples Beispiel: Ein Mann verläßt sein Appartement, er hat sich mit seiner Frau gestritten, will sie verlassen. Und – der älteste Witz der Welt – er rutscht auf einer Bananenschale aus. Als er mit dem Kopf aufschlägt, ruft er: „Maria“ – den Namen seiner Frau. Das ganze ist keine Geschichte bis zu dem Moment, in dem wir wissen, daß er ausgerutscht ist. Die Geschichte beginnt also mit ihrem Ende. Wenn man sich klassische Erzählungen ansiehrt, erzählen sie oft die Geschichte eines Lebens, die mit dem Tod endet. Erst nach dem Tod sieht man das Leben als Geschichte. Da der Erzähler erst an dem Punkt ins Spiel kommt, ist er ein „Sekretär des Todes“. Nicht aber, weil er prinzipiell am Tod interessiert ist.
Realität? Das ist das, in was wir hineingeworfen werden.
Wer sich soviel mit dem Leben und der Kunst auseinandersetzt, müßte auch eine Definition für den Begriff Realität haben. Haben Sie eine?
John Berger: Ich fürchte nicht. Es ist etwas, in das wir hineingeworfen werden. Eine bestechend kurze und prägnante Antwort. Das scheint mir das Vernünftigste zu sein. Entweder man antwortet darauf mit Heidegger oder eben kurz und bündig.
Würden Sie denn sagen, daß Ihr Schreiben einen Einfluß auf die Realitätserfahrung hat?
John Berger: (macht eine hastige, abwehrende Geste) Realität ist kein Produkt, sie läßt sich nicht so ohne weiteres in einen Text transplantieren. Ein großer Teil davon ist und bleibt ein Rätsel.
Aber Schreiben dient doch zumindest der Bestimmung eines kleinen Ausschnittes davon.
John Berger: Richtig. Teilweise schreiben wir, um das besser zu verstehen, in das wir hineingeworfen worden sind. Das Ungesagte bleibt dabei jedoch mindestens ebenso wichtig. Bei Raymond Carver, beispielsweise, resultiert die Spannung aus dem, was ungesagt bleibt.
Was, glauben Sie, macht einen guten Erzähler aus?
John Berger: Keine Ahnung, ehrlich.
Haben Sie nie versucht, es herauszufinden?
John Berger: Nein, aber lassen Sie mich es mit einem Beispiel erklären: Was macht einen guten Athleten aus, einen guten Schauspieler, einen guten Sänger? Ich denke, es gibt dafür kein Rezept.
„Wenn man mit einem neuen Buch beginnt, fällt es oft ziemlich lausig aus.“
Anfangs sagten Sie, Sie hätten eine Menge Schreib-Erfahrung. Wäre das etwas?
John Berger: Gut oder besser – für mich ist das nicht sonderlich interessant. Was mich eher beschäftigt, ist, über kompliziertere und komplexere Dinge zu schreiben. Jedes Mal beginne ich ein komplett neues Buch, wenn wir mal den Bereich „Fiction“ nehmen. Alles, was ich bis zu dem Zeitpunkt geschrieben habe, ist von keinem großen Nutzen dafür. Ich muß wieder völlig von vorne anfangen. Keine Ahnung, ob mir das hilft, ein besserer Schreiber zu werden.
Das Sehen haben Sie mal als wichtigste Form der Wahrnehmung beschrieben. Hätten Sie Angst, blind zu sein?
John Berger: Eine ziemlich interessante Frage. Und zwar aus mehreren Gründen. Erstens, weil ich gerade meinen Roman „To the Wedding“ fertiggestellt habe. Er soll Ende des Jahres auch in Deutschland herauskommen. Oft, wenn man ein neues Buch beginnt, fällt es ziemlich lausig aus. Es wird erst besser, wenn man die Stimme findet, die die Geschichte zu erzählen hat. Möglicherweise ist die Geschichte schon da, aber sie kommt einfach nicht richtig heraus. In diesem Fall fand ich, daß die Geschichte von einem Blinden, einem blinden Griechen, erzählt werden sollte. Er war nicht von Geburt an blind, sondern ist es erst später geworden. Und so habe ich oft darüber nachgedacht, auch wenn es gar nicht das Thema der Geschichte ist. Ein anderer Grund ist – ich schrieb vor einigen Tagen einen Essay über Malerei. Ich sage darin, daß eins der traurigsten – wohlgemerkt nicht tragischsten – Dinge ein Tier ist, das erblindet ist. Wenn das Tier sich auf vertrautem Terrain befindet, kann es sich mit der Nase zurechtfinden. Und dennoch bleibt es ausgeschlossen vom Existierenden. Dieses Ausgeschlossensein führt dazu, daß das Tier mehr und mehr schläft. Und möglicherweise schläft es, in der Hoffnung den Traum des Existierenden zu jagen. Als ich über das Tier schrieb, habe ich möglicherweise auch etwas über mich selbst ausgesagt.
„Ich soll über Hasen geschrieben haben?“
Warum schreiben Sie eigentlich kaum über Gegenwartskunst? Sie schlagen in Ihren Bild-Essays bevorzugt den Bogen zurück in das 17. oder 18. Jahrhundert.
John Berger: Das liegt eigentlich nur daran, daß ich seit 15 Jahren auf dem Land lebe, „begraben“ in einem Dorf. Die Gelegenheit, sich dort mit aktueller Kunst auseinanderzusetzen, bietet sich recht selten.
Klingt einleuchtend. Verwunderlich war lediglich, daß Sie häufig über Hasen schreiben, die aber von Beuys zum Beispiel nie erwähnen.
John Berger: Ich soll über Hasen geschrieben haben?
Ja. Mehrfach in „Und unsere Gesichter…“
Sie bringen mir ja wirklich noch was über mich selbst bei. (lacht)
John Berger: Ich hatte das komplett vergessen. Aber: Das eigentlich Bemerkenswerte daran ist, daß mein jüngster Sohn, er ist 18, Maler werden möchte. Ausgerechnet Maler! Er hat etwa seit einem Jahr an einem Dossier über Hasen gearbeitet. Bilder, Fotos, etc. zusammengetragen. Wenn Sie also jetzt von Hasen sprechen, denke ich zuerst an Yves. Ich hab’ völlig vergessen, daß ich mich auch mit ihnen auseinandergesetzt habe. Aber keine Sorge, die Idee kann er nicht von mir haben. Er hat nie ein Buch von mir gelesen.
Mag er Ihre Bücher nicht?
John Berger: Doch. Nur Lesen ist nicht gerade seine starke Seite. Aber, Scherz beiseite: Er hat – glaube ich – zwei gelesen. Er liest generell nicht viel. Das scheint mir signifikant für seine Generation zu sein. Dafür hat er ein unglaubliches Gedächtnis. Das hatten die Maler zu meiner Zeit nicht.
Auch wenn die Art, mit Kunst umzugehen, bei Ihnen beiden unterschiedlich ist, scheint sie doch eine gemeinsames Ziel zu haben…
„Wenn ich im Kino war, hab ich ein viel stärkeres Gefühl, was es heißt ein Mensch zu sein.“
John Berger: … es muß wohl so sein. Aber ich würde lieber anders darauf antworten: Wenn ich im Kino einen Film gesehen habe, habe ich einen ganz anderen Sinn für’s Leben. Und ein viel stärkeres Gefühl für das, was es heißt, ein Mensch zu sein. Ganz gleich, ob der Film traurig war oder nicht. Wenn ich dies jedoch auf chinesische Kalligraphie anwenden will, glaube ich, stimmt die Definition auch wieder nicht so ganz. Mir scheint jedoch, daß es eine Verbindung zwischen wirklicher Kunst und der Schöpfung, dem Ursprung aller Dinge, gibt. (faßt sich an den Kopf) Aber das zu antworten, ist unverzeihlich. Es klingt so widerlich prätentiös und hohepriesterlich.
Ganz und gar nicht hohepriesterlich ist die Art, mit der Sie über Nacktheit schreiben. In der Kunst wie in der Literatur. Wie kommt es eigentlich, daß Sie so unverkrampft über Liebe und Sex schreiben können?
John Berger: (blickt verschmitzt auf) Schwer zu sagen. Auch wenn ich glaube, daß Sie recht haben. Ich kann nur zwei mögliche Ansätze anbieten. Einer davon ist sicher die Malerei. Als ich damit anfing, verbrachte ich den Großteil der Zeit damit, Akt-Modelle zu zeichnen…
… Richtig. Sie wollten das 24 Stunden am Tag machen…
John Berger: … (lacht) genau. Sicher hat der unkomplizierte Umgang damit zu tun. Irgendwann erkennt man, daß das pure Ansehen des Nackten ein unschuldiger Akt ist, der gleichzeitig die Schönheit des Körpers zelebriert. Dies hat mir möglicherweise beim Schreiben geholfen. Ein anderer Ansatz ist, daß meiner Meinung nach Sexualität etwas ist, das geteilt werden muß – zuerst einmal als etwas Intimes zwischen zwei Leuten. Und darum wüßte ich nicht, warum es nicht auch in einer anderen Form mitgeteilt werden soll, z.B. zwischen dem Autor und Leser. Oder (zuckt mit den Schultern und lehnt sich grinsend zurück) – vielleicht bin ich einfach so geboren.
Wenn man Ihre Bücher liest, weiß man nie, ob Sie ein Maler sind, der schreibt, oder ein Autor sind, der malt. Als was würden Sie sich bezeichnen?
John Berger: Wenn ich’s mir recht überlege, würde ich mich eher als Autor denn als Maler bezeichnen.
„Alle meine Bücher sind quasi Film-Ersatz.“
Auch wenn Ihre Wahrnehmung bildhafter als die eines in Worten denkenden Autors ist?
John Berger: Sicher, das Geschriebene ist bei mir nicht in Sprache konstruiert. Es ist eher wie ein Kino-Film aufgebaut. Eine Art Montage. Was ich vielleicht wirklich bin, ist ein Cineast. Seit meiner Jugend war Filme-Machen mein Traum. Wenn ich am Ende meines Lebens stolz sein will, dann wäre es auf meine Filme – so wie ich hoffe, daß Tarkovsky darauf stolz gewesen sein. mag. Alle meine Bücher sind quasi Film-Ersatz. Der Vorteil am Kino ist, daß es visuell sichtbar ist und gleichzeitig eine Erzähl-Struktur hat. Da kommen dann alle Eigenschaften zusammen: Autor, Erzähler und Maler.
Sie haben aber noch ein paar vergessen: den Mann, der einer Kuh beim Kalben hilft, den Lyriker, den Kunstkritiker. Was verbindet die Facetten – und gibt es eigentlich etwas, das Sie noch sein möchten?
John Berger: Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Sie scheinen immer zu mir zu gehören – ich habe auch gar nicht das Gefühl, verschiedene Rollen zu spielen. Tja, und was ich gern noch wäre… ich glaube …, nun, ich wäre gern ein guter Imker.
Und Ihre Heimat – wo wäre die?
John Berger: Tja… meine Heimat? Ah… unter einem Fliederstrauch. Liegend, in ungemähtem Gras.